In der digitalen Spielewelt ist es ein Phänomen, das viele Gamer zunehmend frustriert: Ein Spiel, das sie einst gekauft haben, wird plötzlich unspielbar, weil die Server abgeschaltet wurden. Was für viele wie ein Einzelfall wirken mag, ist längst ein systemisches Problem geworden, welches die Initative „Stop Killing Games“ angeht.
Gegründet im Jahr 2024 vom US-amerikanischen YouTuber Ross Scott, bekannt durch seinen Kanal Accursed Farms, verfolgt die Bewegung ein klares Ziel: Digitale Spiele müssen auch dann noch spielbar bleiben, wenn Unternehmen ihre Server abschalten oder den Support einstellen. Der Auslöser für Scotts Engagement war das Spiel „The Crew“ von Ubisoft.
Trotz vollständiger Bezahlung konnten Spieler nach dem 1. April 2024 das Spiel nicht mehr nutzen – selbst nicht im Einzelspielermodus. Für Scott war das der Moment, in dem die rote Linie überschritten wurde.
Die zentrale Forderung der Bewegung ist einfach: Ein einmal verkauftes Spiel darf dem Käufer nicht wieder genommen werden – weder durch technische Barrieren noch durch unterlassene Wartung. Stattdessen sollen gesetzliche Regelungen her, die Publisher dazu verpflichten, entweder Offline-Modi oder die Möglichkeit zu privaten Servern bereitzustellen.
Die Vision ist eine Games-Landschaft, in der digitale Produkte genauso beständig sind wie physische – und in der Kulturgüter nicht einfach verschwinden, nur weil der wirtschaftliche Lebenszyklus beendet ist.
Ein Weckruf für die Politik und die Branche
„Stop Killing Games“ entwickelte sich rasch zu einer europaweiten Bewegung. Bereits nach wenigen Monaten erreichte die EU-Bürgerinitiative mehr als 1,4 Millionen Unterschriften. Dieser Erfolg verpflichtet die Europäische Kommission und auch das EU-Parlament, offiziell auf die Forderungen zu reagieren.
Zur gleichen Zeit lief in Großbritannien eine Petition, die mit über 100.000 Unterstützern die Voraussetzung für eine parlamentarische Debatte erfüllte. Zusätzlichen Rückhalt erhielt die Bewegung durch prominente Stimmen.
So stellte sich der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Nicolae Ștefănuță, klar hinter die Initiative und betonte, dass ein Spiel, das einmal verkauft wurde, dem Käufer gehört und nicht dem Unternehmen.
Auch innerhalb der Industrie fand die Initiative Zustimmung. Studios wie Owlcat Games, bekannt für Rollenspiele wie Pathfinder oder Warhammer 40K: Rogue Trader, unterstützen die Bewegung, obwohl ihre eigenen Titel nicht unmittelbar betroffen sind. Für viele Entwickler geht es ums Prinzip: Kunden müssen sich darauf verlassen können, dass ein gekauftes Produkt nicht plötzlich unbrauchbar wird.
Trotzdem bleibt die Resonanz in der Branche gespalten. Kleinere Studios und einzelne Entwicklerpersönlichkeiten zeigen sich offen für die Forderungen, während große Publisher über ihre Interessenvertretung Video Games Europe erhebliche Bedenken äußern.
Sie verweisen darauf, dass verpflichtende Offline-Modi oder die Freigabe privater Server mit erheblichem technischen und rechtlichen Aufwand verbunden wären, besonders im Hinblick auf geistiges Eigentum und komplexe Mehrspieler-Mechaniken.
Hinzu kommen mögliche Probleme im Bereich des Datenschutzes und bei der Wahrung der Spiellogik, falls Communities eigenständig Server betreiben würden.
Digitales Eigentum und kulturelles Gedächtnis
Die Kontroverse geht weit über technische Fragen hinaus und berührt grundlegende Überlegungen zum Eigentum in der digitalen Welt. Während ein physisches Buch oder Spiel auch Jahrzehnte nach dem Kauf genutzt werden kann, sind viele digitale Inhalte an laufende Dienste gebunden.
Wird ein Server abgeschaltet, verliert der Käufer den Zugang, selbst wenn das Spiel vollständig auf der eigenen Festplatte installiert ist. Die Initiative „Stop Killing Games“ sieht darin nicht nur ein Problem des Verbraucherschutzes, sondern auch eine kulturelle Herausforderung. Denn jedes Spiel, das einfach verschwindet, bedeutet einen Verlust für das kollektive digitale Gedächtnis.
Kritik an der Initiative entzündete sich zudem an dem Vorwurf, Ross Scotts ehrenamtliche Arbeit sei als nicht deklarierter finanzieller Beitrag verschwiegen worden. Nach den Regeln der EU-Bürgerinitiativen gelten freiwillige Tätigkeiten jedoch nicht als finanzielle Unterstützung. Scott stellte dies klar und betonte, dass die gesamte Kampagne ohne wirtschaftliche Interessen betrieben werde.
Ob die Bewegung tatsächlich zu gesetzlichen Veränderungen führt, bleibt abzuwarten. Der Druck auf Publisher wächst jedoch spürbar – nicht nur durch Proteste, sondern auch durch eine zunehmend informierte und engagierte Spielerschaft. Damit hat „Stop Killing Games“ bereits mehr erreicht als bloße Aufmerksamkeit. Die Initiative hat das Thema auf die europäische Agenda gebracht und damit Millionen Spieler eine Stimme gegeben, die bislang kaum gehört wurden.
Aktuller Stand der Initiative
Die Initiative „Stop Killing Games“ wollte erreichen, dass Publisher für verkaufte Spiele verbindliche End-of-Life-Pläne bereitstellen, sodass sie nach Serverabschaltungen weiter spielbar bleiben, ohne dabei eine Pflicht zu unendlichem Support oder zum Umbau von Multiplayer in Singleplayer zu fordern.
In der EU besteht aktuell eine rechtliche Grauzone: Vertragsklauseln, die Spiele jederzeit abschaltbar machen, könnten zwar gegen die Richtlinie 93/13/EWG zu unfairen Klauseln verstoßen, es gibt aber keine klaren Gesetze zur Laufzeit digitaler Käufe.
Der wichtigste Hebel, die Europäische Bürgerinitiative, die bis zum 31. Juli eine Million Unterschriften benötigt, wird mit nur etwa der Hälfte wohl scheitern; die parallele UK-Petition steckt fest. Unabhängig davon laufen Verfahren und Untersuchungen in Deutschland, Frankreich und Australien, die eventuell zu Bußgeldern oder Auflagen führen könnten.
Als indirekter Erfolg gilt, dass Ubisoft angeblich Offline-Modi für The Crew 2 und Motorfest angekündigt hat, um Druck abzufangen. Die größten Probleme der Kampagne waren mangelnde Reichweite, allgemeine Apathie, fehlende Werbemöglichkeiten und laut Initiator Fehlinformationen durch Kritiker, die den Ansatz falsch dargestellt haben.
Nach dem 31. Juli wird der Initiator die Kampagnenarbeit einstellen, da sie ihn finanziell und zeitlich stark belastet hat, während die laufenden Verfahren nun die einzige Chance darstellen, Veränderungen zu erzwingen. Ob daraus klare Regeln oder lediglich kosmetische Anpassungen entstehen, ist offen; ohne Erfolg bleibt der Status quo zementiert, und Verbraucherrechte bei Online-Spielen bleiben minimal.
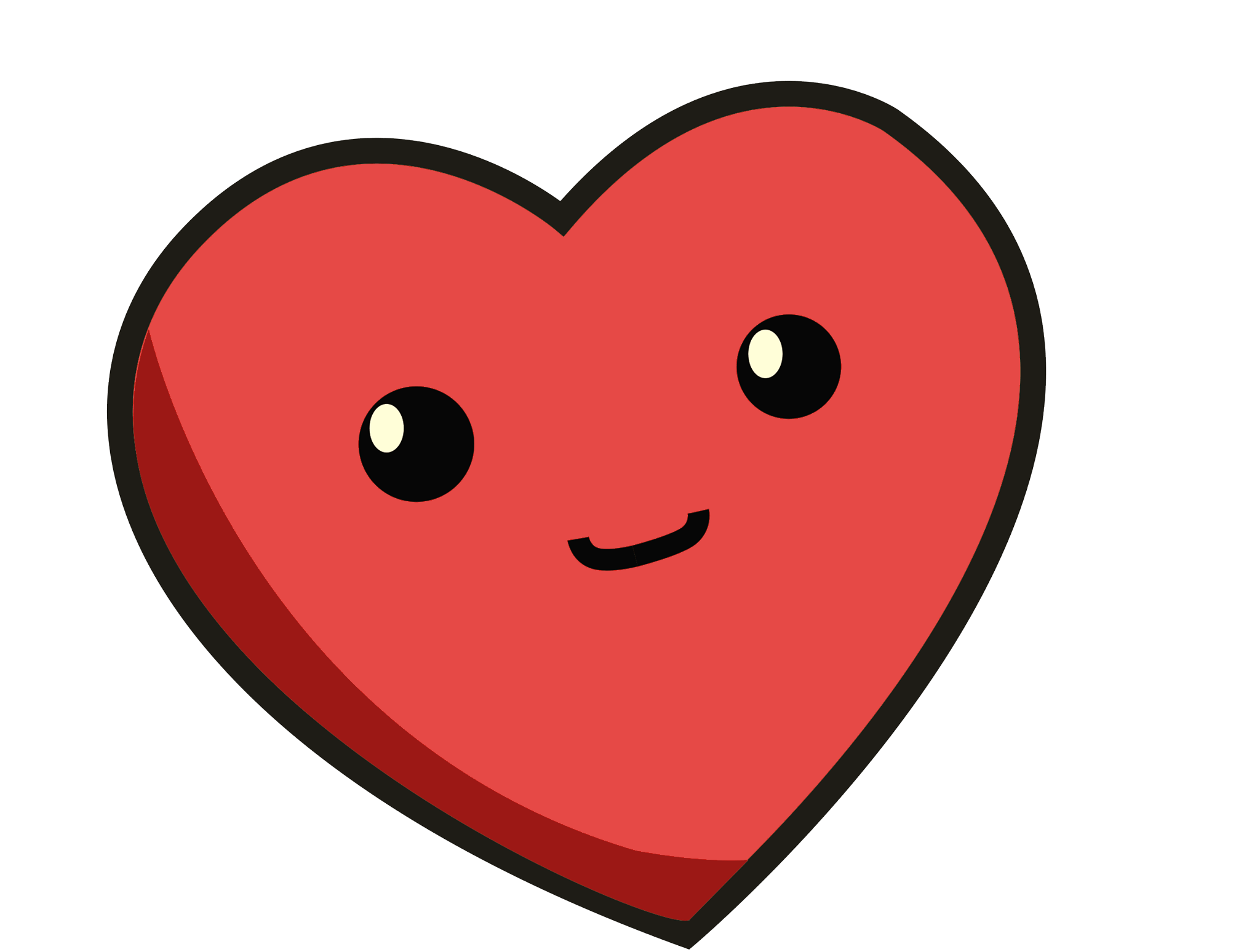
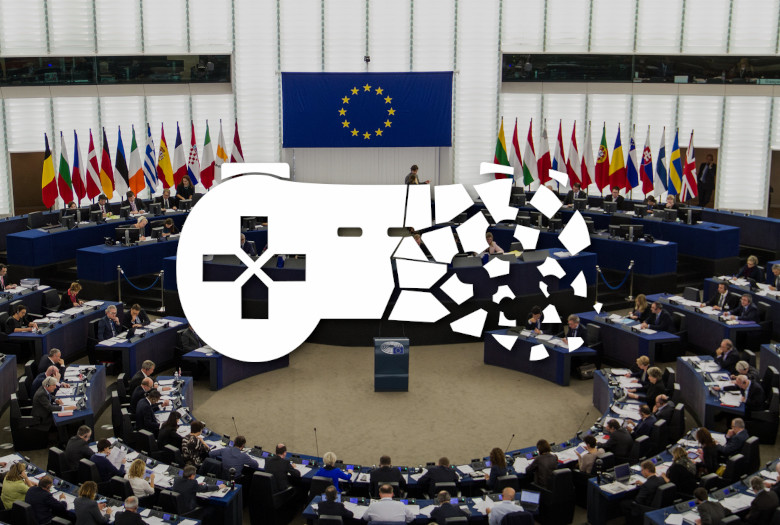
Ein Kommentar
Pingback: Ohne Vorwarnung: Disney delistet mehrere Klassiker auf Steam